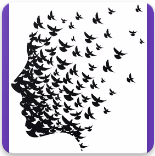B E H A N D L U N G E N
Glaubenssätze auflösen
Hier finden Sie Hintergrundinformationen, einen Angst-Test und einen effektiven Ansatz zur Behandlung von Glaubenssätzen.
Glaubenssätze auflösen
„Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab.“ Marcus Aurelius (121-180) römischer Kaiser und Philosoph
Sie finden Hintergrundinformationen über Kognitionen/Glaubenssätze und Schemata auf dieser Seite. Im Folgenden verstehen wir Glaubenssätze, Kognitionen, Überzeugungen und Schemata als synonym.
Jede Kindheit, auch die glücklichste, durchläuft tiefe psychische Verletzungen, Traumata, Grundkonflikte und es entstehen viele irrationale Überzeugungen/dysfunktionale Kognitionen/negative Glaubenssätze (zum Beispiel: „Ich bin schlecht“, „Ich bin nichts wert“, „Ich kann nichts“). Wir laufen mit diesem schädlichen Ballast unser ganzes Leben lang umher, meistens ohne sie zu bemerken, denn sie sind uns fast immer unbewusst. Diese Überzeugungen formen und lenken uns und unser Denken, Fühlen und Handeln.
Aber: Alles was wir glauben, kann auch wieder vom Glauben losgelassen werden. Dazu benutzen wir einfache und doch effektive Methoden, die ohne Konfrontation und auch ohne Reise in die Vergangenheit auskommen. Das Besondere ist, dass wir dies gründlich machen. Das betonen wir, weil die meisten Ansätze und Methoden nur die Glaubenssätze und Kognitionen auf der kognitiven Ebene lösen. Aber das ist unvollständig, denn man muss zur gründlichen Behandlung, auch die Anspannung, Verspannung und Belastung der Glaubenssätze auflösen. Denn gerade die Anspannung wirkt meistens oft sehr schwer.
„Niemand glaube, die ersten Eindrücke der Jugend überwinden zu können.“ Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832), deutscher Dichter der Klassik, Naturwissenschaftler und Staatsmann.
Glaubenssätze-Test
Wenn Sie schon eine Kognition bzw. Überzeugung in Verdacht haben, können Sie sich auf diese testen, ob sie auch wirklich in Ihnen ist. Das machen Sie mit unserem kostenlosen Glaubenssatz-Test, den Sie rechts am Bildschirm finden. Dieser Test prüft nicht nur auf Ängste, sondern auch auf Kognitionen. Tippen Sie den Glaubenssatz einfach im Test ein und überprüfen Sie sich damit. Geben Sie immer folgendes Format ein: (ohne Anführungszeichen)
„den Satz Ich bin nichts wert“
oder
den Satz Ich bin nicht gut genug“
Wenn Sie dort fündig geworden sind, kann die Kognition bzw. der Glaubenssatz mit unserer Angst Auflösen App aufgelöst. Den Link dazu finden Sie weiter unten.
Negative Glaubenssätze auflösen
Die Herausforderung ist jetzt, die spezifischen Glaubenssätze zu finden, denn nur, wenn wir sie spezifiziert und benannt haben, können wir sie bearbeiten. Es geht fast immer um die allgemeinsten Formulierungen, also nicht „Ich fühle ich schon wieder wertlos“, sondern „Ich bin wertlos.“
„Du bist nicht verantwortlich für Deine Programmierung aus der Kindheit. Aber als ein Erwachsener bist Du zu 100 % verantwortlich, um das zu heilen. Wenn Du anderen die Schuld gibst, gibst Du Deine Kraft zur Veränderung auf.“ David Avocado Wolfe, US-amerikanischer Autor
Frage: Wieso sollten in uns solche schädlichen Überzeugungen liegen?
In der frühkindlichen Zeit waren wir hilflos und abhängig, machtlos und angewiesen auf Hilfe, Liebe, Zuneigung, Reinigung, Nahrung und Bestätigung von außen. Doch als der Verstand und damit auch das Weltbild in Erscheinung trat, konnten wir uns dort in eine schützende Enge flüchten. Diese innere Enge war das beruhigende Abbild der Welt mit seinen Erklärungen, Glauben, Rationalisierungen, Versprechen und Hoffnungen. Mit diesem Rückzug vermieden wir Angst, Schmerz, Unsicherheit und andere weitere überfordernde und „negative“ Aspekte. Es wirkt beruhigend, wenn das Weltbild überschaubar ist, wenn wir verstehen können, was im Innern und im Außen abläuft, wenn wir verstehen, was vor sich geht. Denn dann glauben wir insgeheim, wir könnten es kontrollieren, sodass es keinen Grund zum Fürchten gibt. Gerade in den frühkindlichen Jahren gab uns daher Glauben und Wissen Sicherheit und (scheinbare) Kontrolle vor dem Unsicheren, die Außenwelt und die Angst-machende Dynamik der Kräfte in unserem Inneren. Außerdem begehren wir unbewusst Glauben und Wissen, weil es auch unser Selbst- und Weltbild stärkt und verfestigt und uns damit auch wieder Sicherheit, Macht und (scheinbare) Kontrolle gibt.
„Hüte Dich vor negativen Gedanken, denn sie greifen Körper und Geist an. Sie sind die ersten Symptome des Übels. Heile Deinen Geist, wenn Du Deinen Körper heilen willst.“ Tibetische Volksweisheit
Frage: Reicht es nicht, wenn ich mir nur positive Glaubenssätze installiere?
Selbst wenn wir uns eine positive Kognition in unser Glaubenssystem tief verankern, sind die negativen Glaubenssätze doch meistens weitaus mächtiger. Normalerweise wählt man sich ja das Thema aus, bei dem Optimierungsbedarf besteht. Höchstwahrscheinlich, weil man in diesem Gebiet schon viele negative Überzeugungen in sich hat. Mächtiger und wirkungsvoller sind die negativen Glaubenssätze, denn gerade diese sind eigentlich immer mit einer stark aufgeladenen Anspannung, in einer signifikanten, traumatischen Situation entstanden. Wenn man sich nur neue positive Glaubenssätze installieren würde, ohne die alten negativen aufzulösen, werden die alten Glaubenssätze dadurch nicht unwirksam. Das führt zu keinem Erfolg, höchstens zu weiteren inneren Konflikten und man wird durch diese vielen Gegenabsichten „unbeweglicher“ und steifer.
Mit der „Glaubenssätze-Auflösen“ App, können ohne Affirmationen (ständige Wiederholungen), negative Glaubenssätze gründlich behandelt werden, deren Belastung/Anspannung abgebaut werden und neuen positiven Glauben/unterstützende Kognitionen in das Glaubenssystem tief und fest verankert werden. Die App behandelt Glaubenssätze auf zwei Ebenen und nicht nur auf der mentalen Ebene. Nur das ist eine gründliche Behandlung. Fangen Sie an!
Viel Erfolg!
Typische negative Glaubenssätze/Typische dysfunktionale Glaubenssätze
Ich bin nicht gut
Ich bin ein Opfer
Ich darf nicht
Ich bin ein Verlierer
Ich bin hilflos
Ich bin nicht gut genug
Ich bin nicht gut wie Ich bin
Ich bin nicht normal
Ich bin nicht wichtig
Ich bin nichts Besonderes
Ich bin nichts wert
Ich bin wertlos
Ich bin nur etwas wert, wenn Ich Leistung bringe
Ich bin nur etwas wert, wenn Ich Liebe bekomme
Ich bin nutzlos
Ich bin unerwünscht
Ich bin unwichtig
Ich bin unzulänglich.
Ich bin zu nichts fähig
Ich bin zu nichts zu gebrauchen
Ich darf keine Fehler machen
Ich darf keine Liebe fühlen
Ich will keine Liebe fühlen
Ich will keine Liebe zeigen
Ich darf keine Liebe fühlen
Ich darf keine Liebe zeigen
Ich darf mich nicht öffnen
Ich darf mich nicht zeigen
Ich darf mich zeigen
Ich darf nicht böse sein
Ich darf nicht gesehen werden
Ich darf nicht ich selbst sein
Ich darf nicht Nein sagen
Ich kann mich nicht anpassen
Ich kann mich nicht ausdrücken
Ich kann mich nicht durchsetzen
Ich kann mich nicht entscheiden
Ich kann mich nicht verändern
Ich kann nicht
Ich kann nichts
Ich kann nicht “Nein” sagen
Ich kann nie was richtigmachen
Ich mach alles falsch
Ich muss besser sein als alle anderen
Ich muss mich beweisen
Ich muss mich unterwerfen
Ich schaff nichts
Ich verdiene keine Liebe
Bei allen Fragen ...
... zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Ob ob es dabei um eine Verständnisfrage geht, Produktdetails oder Fragen zur Behandlung.
Wir helfen gerne!
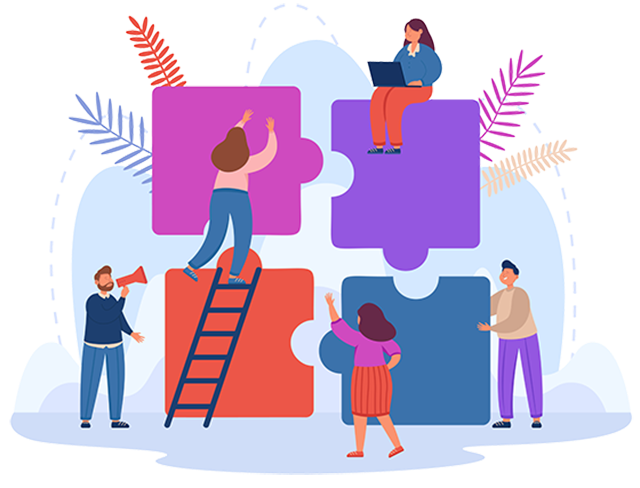
Kaufen Sie jetzt die "Glaubenssatz Auflösen" App für nur 14,99 Euro!
Erhältlich im Apple™ App-Store oder im Google™ Playstore.
Für weitere Informationen über die App lesen Sie hier.

„Wenn der Glaube stark ist, kann er Berge versetzen. Aber ist er auch noch blind, dann begräbt er das Beste darunter.“
Karl Heinrich Waggerl (1897-1973) österreichischer Schriftsteller